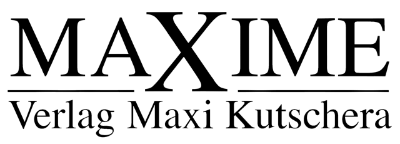Vorwort von Matthias Kielwein
„Wenn man so durch die Straßen flanirt und ein wenig Placatstudien macht, so findet man, daß unter all‘ den vielen Placaten die der Fahrrad- und Pneumaticfabriken beinahe schon die Majorität haben. Das ist übrigens ganz natürlich. Der ‚Bicyclewahnsinn‘ hat ja die ganze Welt ergriffen, und im Zusammenhange mit der rapiden Entwicklung der Fahrrad- und Pneumaticindustrie steht auch die augenfällige Vermehrung der bezüglichen Placate.“
Neues Wiener Tagblatt, Nr.114, 25. April 1897, S.26
Was der Redakteur des Neuen Wiener Tagblatts 1897 in seinen einleitenden Worten zu einer Beschreibung diverser Fahrradplakate „Bicyclewahnsinn“ nennt, bezeichnet den – im Englischen „bicycle craze“ genannten – Fahrradboom der 1890er Jahre. Das breite Gesellschaftsschichten erfassende Niederrad mit Luftbereifung hatte in kurzer Zeit das elitäre Hoch- und Dreirad verdrängt und einen enormen Bedarf nach individuellem Langstreckenverkehr geschaffen, der erst durch das massenhafte Aufkommen motorisierter Fahrzeuge befriedigt werden sollte (James J. Flink: The Automobile Age, 1988).
Tageszeitungen und Zeitschriften berichteten umfangreich über das moderne Sport- und Verkehrsmittel, dem mitunter sogar ganze Sonderhefte gewidmet wurden. Eine Vielzahl von Fachmagazinen und Büchern informierte über radsportliche Ereignisse und Leistungen sowie neueste Modelle und technische Entwicklungen. Die boomende Fahrradindustrie warb regelmäßig in illustrierten Anzeigen für ihre Produkte und nutzte bald auch das künstlerische Plakat als modernes Reklamemittel, von dem wiederum die Druckindustrie profitierte: Von 40 Reklameplakaten, die die Leipziger Kunstanstalt Grimme & Hempel 1898 in einer fünfseitigen Anzeige in der Leipziger Illustrierten Zeitung präsentierte, kamen 18 aus der Fahrrad- und Fahrradreifenbranche.
Die vorliegende Sammlung von Plakaten spiegelt die kulturelle, technische und volkswirtschaftliche Bedeutung des Fahrrades über einen Zeitraum von rund 70 Jahren. Die geschichtliche Einordnung der Plakate erfolgt hier nicht aus kunsthistorischer Perspektive, im Zentrum steht vielmehr deren Datierung und ein kurzer Abriss der Firmengeschichte des jeweiligen Fahrradherstellers auf der Basis von Firmierungsdaten aus zeitgenössischen Quellen.
Zusätzlich zum graphischem Stil eines Plakatentwurfs und der Kleidermode der abgebildeten Personen ermöglichen Signaturen, technische Details der dargestellten Fahrzeuge, Patente, Markennamen und Warenzeichen, Musterregistereinträge, im Handelsregister eingetragene Firmennamen von Fahrradherstellern und Druckereien, die Verwendung der Plakatmotive in datierten Zeitungsanzeigen sowie die Präsentation eines Plakats als Neuheit in einer Zeitschrift eine enge zeitliche Eingrenzung des Entstehungsjahrs eines Plakats. Der Begriff Entstehungsjahr ist allerdings nicht eindeutig: zu unterscheiden sind der Zeitpunkt des Entwurfs, des Drucks sowie der Auslieferung an die Händler. Mitunter wurden Entwürfe unter neuer Firmierung später erneut verwendet oder abgeändert neu aufgelegt. Welches Datum jeweils konkret gemeint ist und dessen Genauigkeit ergibt sich aus den zitierten Quellen.
Bei den Zitaten im Bildteil handelt es sich um zeitgenössische, den damaligen Zeitgeist widerspiegelnde Plakatbeschreibungen, die zwar im redaktionellen Teil von Zeitschriften erschienen, aber sicher von der Reklameabteilung des jeweiligen Fahrradherstellers zur Verfügung gestellt wurden, denn häufig erschienen identische Texte zeitgleich in verschiedenen Journalen. Die zitierten Texte wurden dabei in Ausdrucksform und Wortwahl unverändert belassen und nur behutsam bei Interpunktion und Rechtschreibung korrigiert.
Der besondere Dank geht an Karl-Friedrich Marks, Heinz Fingerhut (velo-classic), Frank Papperitz und die Stiftung Deutsches Technikmuseum, die ihre Sammlungen zugänglich gemacht haben, um ein breites, sich gegenseitig ergänzendes Spektrum an Plakaten von 1886 bis 1957 abzudecken, und somit ein solides Fundament gelegt haben, um dieses Buch überhaupt zu ermöglichen. Florian Freund, der den Großteil der Plakate professionell reproduziert und mit wichtigen Quellenrecherchen beigetragen hat, hat dieses Projekt maßgeblich mitgetragen (siehe auch die Danksagung am Beginn des Katalogteils).
Matthias Kielwein
Dresden, im Juli 2024
Blick ins Buch – Video: